„Faserland“: Der Schweizer Autor Christian Kracht schuf mit diesem kleinen Roman eines der wichtigsten Werke der deutschen Popliteratur. Autobiographische Motive in dem Bericht über die turbulente Reise mit Startpunkt Sylt und Endpunkt Zürich sind unbestreitbar.
Popliteratur – was ist das eigentlich? Versucht man sich über die gängigen Wissens- und Informationsportale ein klareres Bild darüber zu verschaffen, so kann man zusammenfassend sagen: Diese nicht klar zu definierende Literaturgattung drückt sich in Werken aus, die eine meist jugendliche Subkultur und deren Unzufriedenheit mit dem herrschenden gesellschaftlichen Mainstream beschreiben, indem sie auf realistische Weise auf jegliche kulturelle Aspekte der jeweiligen Zeit, seien es Kunst, Musik, Medien, aber auch und vor allem Politik, Bezug nehmen. Dass dies möglichst anspruchsvoll geschieht, ist dabei kein Ziel, vielmehr soll dieses realistisch, an der „Popkultur“ orientiert, rüberkommen. Dass Popliteratur dann auch meist so geschrieben ist, wie die Menschen wirklich sprechen und denken, ist ein Aspekt, der das zeigt.
Popliteratur – Gesellschaftskritik so wie man wirklich spricht
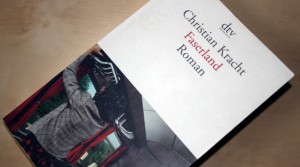 So ist es denn auch kein Wunder, dass Krachts Werk angesichts dieser wissenschaftlichen Merkmale, die man für diese Gattung ausgemacht hat, als Paradestück oder Initialzündung einer neuen deutschen Popliteratur-Welle ab Mitte der 90er Jahre gefeiert wurde. Der Ich-Erzähler, über den man nicht viel mehr erfährt, als dass er der Spross einer offensichtlich wohlhabenden Familie ist, einen exquisiten Modegeschmack pflegt und in entsprechenden Kreisen verkehrt, verstrickt sich auf seiner Reise quer durch Deutschland in die absurdesten und peinlichsten Begebenheiten rund um Drogen, Party, Freundschaft und Sex. Unterbrochen werden diese von Momenten der einsamen Reise, meist per Zug und Flugzeug nach überstürztem und spontanem Verlassen der Szenerie, in denen aufmerksame und zynische Beobachtung und Beschreibung seiner Umwelt abwechseln mit dem tiefsinnigen Schwelgen in nostalgischen Kindheitserinnerungen und Anekdoten rund um die, meist recht eigenwilligen, alten Schulfreunde vom Eliteinternat, was dann oft in Gedanken an Selbstfindung und Entfremdung mündet. Auch hat man an diesen Stellen des öfteren den Eindruck, dass der Protagonist sich seine latente Homosexualität nicht eingestehen möchte, ja sogar davor zu fliehen scheint. Das drückt eine tiefe Traurigkeit aus und ist doch recht amüsant, und die Unverschämtheit, mit der der Erzähler alles mögliche um sich herum auf meist sehr bösartige Weise beschreibt und in groteske und von Vorurteilen bestimmte Phantasiegeschichten einbindet, treibt einem beim Lesen schon manchmal ein schadenfrohes und zustimmendes Grinsen ins Gesicht. Personen der Zeitgeschichte wie Wim Wenders oder Matthias Horx, die Deutsche Bahn, die SPD, Betriebsräte, Hippies, Antifaschisten, Ökos und Rentner, aber auch Frankfurt und bunte Brillen sowie vieles andere bekommen ordentlich ihr Fett weg, alles gespickt mit einer schönen Portion political incorrectness und dem einem unglaublichen Halbwissen entspringenden Anspruch, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben.
So ist es denn auch kein Wunder, dass Krachts Werk angesichts dieser wissenschaftlichen Merkmale, die man für diese Gattung ausgemacht hat, als Paradestück oder Initialzündung einer neuen deutschen Popliteratur-Welle ab Mitte der 90er Jahre gefeiert wurde. Der Ich-Erzähler, über den man nicht viel mehr erfährt, als dass er der Spross einer offensichtlich wohlhabenden Familie ist, einen exquisiten Modegeschmack pflegt und in entsprechenden Kreisen verkehrt, verstrickt sich auf seiner Reise quer durch Deutschland in die absurdesten und peinlichsten Begebenheiten rund um Drogen, Party, Freundschaft und Sex. Unterbrochen werden diese von Momenten der einsamen Reise, meist per Zug und Flugzeug nach überstürztem und spontanem Verlassen der Szenerie, in denen aufmerksame und zynische Beobachtung und Beschreibung seiner Umwelt abwechseln mit dem tiefsinnigen Schwelgen in nostalgischen Kindheitserinnerungen und Anekdoten rund um die, meist recht eigenwilligen, alten Schulfreunde vom Eliteinternat, was dann oft in Gedanken an Selbstfindung und Entfremdung mündet. Auch hat man an diesen Stellen des öfteren den Eindruck, dass der Protagonist sich seine latente Homosexualität nicht eingestehen möchte, ja sogar davor zu fliehen scheint. Das drückt eine tiefe Traurigkeit aus und ist doch recht amüsant, und die Unverschämtheit, mit der der Erzähler alles mögliche um sich herum auf meist sehr bösartige Weise beschreibt und in groteske und von Vorurteilen bestimmte Phantasiegeschichten einbindet, treibt einem beim Lesen schon manchmal ein schadenfrohes und zustimmendes Grinsen ins Gesicht. Personen der Zeitgeschichte wie Wim Wenders oder Matthias Horx, die Deutsche Bahn, die SPD, Betriebsräte, Hippies, Antifaschisten, Ökos und Rentner, aber auch Frankfurt und bunte Brillen sowie vieles andere bekommen ordentlich ihr Fett weg, alles gespickt mit einer schönen Portion political incorrectness und dem einem unglaublichen Halbwissen entspringenden Anspruch, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben.
Political incorrectness und Pseudo-Rebellion
Verbunden wird all dies an vielen Stellen immer wieder mit dem großen Thema Deutschland. Nahezu jedesmal, wenn er alte Menschen erblickt oder in eine andere Stadt kommt, in der ihm irgendetwas Bautechnisches auffällt, stellt der Ich-Erzähler einen Bezug zur Zeit des NS-Regimes oder zur Kriegszeit her. Auch beschreibt er immer wieder implizit typisch Deutsches und zieht es teils in eine Lächerlichkeit, welche einen Bruch mit der Elterngeneration und auch eine pseudo-rebellische Einstellung gegen das Establishment darstellt, pseudo, weil all dies angesichts des Kontrastes zu dem exklusiven Lebensstil des Erzählers recht halbherzig und unglaubwürdig erscheint. Deutschland oder das Deutsche, es entsteht der Eindruck einer intensiven Hassliebe des Erzählers und er wirft die Frage auf, ob es so etwas jemals gegeben hat oder gibt, und wenn ja, was das ist und wohin es sich bewegt. Das mag nach Nationalismus klingen, gemeint ist aber vielmehr die Suche nach Heimat und Identität. „Faserland“ – was meint Kracht mit diesem Titel? Deutschland, ein Land, das sich in einem Prozess der „Zerfaserung“, des Identitäts- und Niveauverlustes befindet? Daneben aber wohl auch den Ich-Erzähler, der sich ebenfalls in einem Auflösungsprozess befindet, der mit jeder weiteren Etappe der Reise über die Stationen Hamburg, Frankfurt, Heidelberg, München und Meersburg fortschreitet und schließlich in Zürich endet. Der dandyhafte Lebensstil des der gesellschaftlichen Elite entstammenden End-Zwanzigers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Deutschlandreise des einsamen und sinnsuchenden Protagonisten um eine Art Abschiedstour handelt, die in der Schweiz, als dem Sinnbild für die heile, gut behütete Welt, letztes Refugium dessen, was sich viele unter „typisch“ oder „urdeutsch“ vorstellen, ihre Vollendung findet.
Wie diese aussieht, soll hier nicht verraten werden und ist letzten Endes sowieso wohl eher dem Leser überlassen. Zwar ist der Roman schon gut 15 Jahre alt, regt aber immer noch ungemein zum Nachdenken an und versteht es dabei trotzdem, den Leser enorm zu erheitern, selbst dann noch, wenn man ihn zum dritten, vierten oder fünften Mal liest. Kurz und gut: Ein wunderbares Stück deutscher Popliteratur der subversiven Sorte eines herausragenden und empfehlenswerten Autors.


Kommentar verfassen