Mit einem szenischen Doppelabend gedachte man im Theater Trier am Sonntag, 26. Oktober, nicht nur den Schrecken und Opfern des Ersten Weltkrieges, sondern warf auch einen Blick auf die Heimatfront in Trier und beleuchtete, wie es zu diesem Krieg kommen konnte, der ganz Europa betraf.
Trier. 100 Jahre ist es her, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. 1914 versank Europa für vier Jahre in Kriegswirren, Schützengräben und massenhaftem Sterben. Heute, im Jahr 2014, ist ein Blick in die Vergangenheit wichtiger denn je, um die richtigen Schritte in die Zukunft tun zu können. Im Theater Trier warf man in Zusammenarbeit mit der Universität Trier und weiteren zehn Kooperationspartnern, wie der Tufa, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Rheinland-Pfalz oder der Friedrich-Ebert-Stiftung, einen solchen Blick in die Vergangenheit. Und dies gleich zweimal.
Nach den Begrüßungen durch Kulturdezernenten Thomas Eggers und, in Vertretung für Malu Dreyer, Frau Dagmar Barzen, Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, folgten gleich zwei szenische Ausarbeitungen zu dem Stoff rund um den Ersten Weltkrieg.

Die erste Ausarbeitung „Wahnsinn wäscht die Hände – Europa macht mobil“ erfolgte durch Intendant Gerhard Weber, in der Dramaturgie begleitet von Dr. Peter Larsen, und befasste sich mit der Frage, wie es überhaupt zu diesem verhängnisvollen Krieg kommen konnte, der Millionen Tote auf allen Seiten forderte. Die Vorkommnisse, die letztendlich zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges geführt hatten, sind zweifellos aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Doch allzu oft erscheinen die rasanten und verzwickten Abläufe in diesem, wie ein unübersichtliches Gewebe aus politischem Kalkül und Bürokratie. Die Frage bleibt, wie es dazu kommen konnte, dass damals dieser Weg gewählt wurde. Diesen Fragen und diesem Chaos wandte Weber sich zu und versucht, ihnen mithilfe seiner Schauspieler auf die Schliche zu kommen. In schwarzen Fräcken traten Generäle und Minister, Staatssekretäre und Botschafter auf. Ein Hut mit der jeweiligen Landesflagge gab zu erkennen, mit welcher Macht man es jeweils zu tun hatte. Nicht Personen traten bei Weber auf, sondern Repräsentanten, gespielt wurden sie von Christian Miedreich, Tim-Olrik Stöneberg, Klaus-Michael Nix und Markus Friedmann. Barbara Ullmann und Alina Wolff als Zar Nikolaus II. und Kaiser Wilhelm II. dagegen im weißen Frack, mit dem Rücken zum Publikum, in einem hohen Lehnstuhl sitzend. Wenn Verträge und Abkommen unterschrieben wurden, sah der Zuschauer auch hier auf gesichtslose Mächte, die hinter ihrer Lehne abtauchten. Gast-Schauspieler Michael Mendl trug am Pult eindrucksvoll Briefwechsel zwischen Zar Nikolaus und Kaiser Wilhelm, kurz Niki und Willi, vor, verlas zudem Forderungen und Erklärungen sowie Kriegsreden.

Webers Inszenierung ist vor allem eines: wortgewaltig. Die Vorgänge, die zur Ausrufung des Weltkriegs geführt haben, sind kompliziert und ausladend, die zeitgenössische Sprache macht es nicht einfacher. Was beim Zuschauer ankam, war das Gefühl, Supermächten ausgeliefert zu sein, jedes Wort und jede Geste wurde auf die Goldwaage gelegt. Und während der Ablauf des ganzen mühsam aufgedröselt wurde, verfestigte sich die Frage im Kopf: Wie konnte es dazu kommen? Was hätte passieren müssen, um den Krieg zu verhindern?
Den zweiten Teil durfte der Zuschauer dann aus einer gänzlich anderen Perspektive erleben, statt im Zuschauerraum saß er nun auf der Bühne, die vier Akteure Alina Wolff, Tim-Olrik Stöneberg, Markus Friedmann und Klaus-Michael Nix im Zuschauerraum. Die szenische Inszenierung von „Aufmarsch Trier – So bitte ich Sie, doch meiner zu gedenken“ von Steffen Popp, in der Dramaturgie von Peter Oppermann und unter Mitwirkung von Studierenden der Universität Trier, befasste sich in Gegenwart und Vergangenheit mit den Auswirkungen des Krieges auf die Trierer. Die Schauspieler lasen teils mit akustischer Untermalung durch Schlagzeuger Oliver Augst aus Briefen, Bittgesuchen an die DRK, Tagebucheinträgen eines evangelischen Pfarrers und Zeitungsartikeln sowie Aufrufen der damaligen Tageszeitung vor. Parallel dazu wurde das Regelwerk des Spiels „Mensch, ärgere dich nicht“ vorgetragen, welches im Zeitraum des Ersten Weltkrieges entstand. Bei Fliegeralarm warfen sich die Schauspieler hinter die Sitze, beim Mensch-ärgere-dich-nicht hopsten sie durch die Reihen, nach Metallteilchen zur Munitionsbereitung fragend gingen sie die Zuschauerreihen ab.

Steffen Popps Inszenierung wirft einen privateren Blick zurück, beleuchtet wie es den Menschen an der Heimatfront gegangen ist, wie der Alltag bewältigt werden konnte und was von den Schrecken des Krieges Zuhause ankam. Und was auch heute noch davon ankommt: 2013 wurden die sterblichen Überreste deutscher Soldaten vor dem Trierer Büro der Kriegsgräberfürsorge abgelegt. Die Erde von Verdun soll sie wieder frei gegeben haben. Dies passiert dort bis heute.
Zwei sehr unterschiedliche Inszenierungen, die aber am Schluss doch ein Bild ergeben: Einmal von der politischen, geschichtlichen Seite aus beleuchtet und einmal von der privaten, alltäglichen Seite. Dem Zuschauer bleibt ein Gefühl für die Vorgänge, für die Greuel und langwährenden Nachwirkungen eines Krieges und eine Ahnung davon, wie schnell der Frieden ins Schwanken geraten kann. Und wie wichtig es ist ihn zu erhalten.
Fotos: Theater Trier

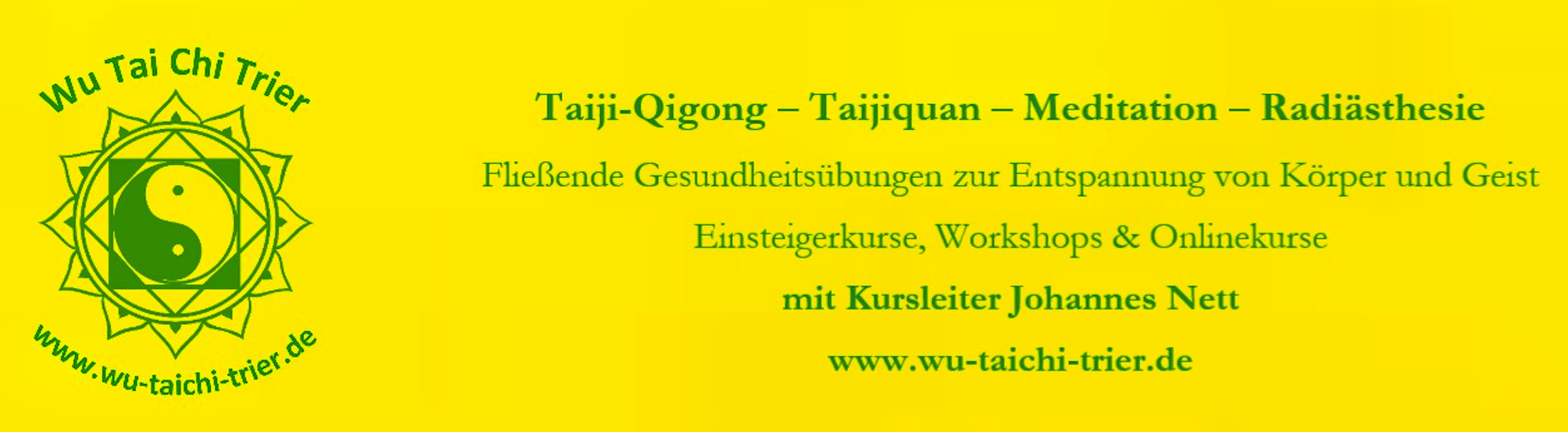
Guenther Troege meint
Diese Art der Beschäftigung mit Geschichte, insbesondere mit dem Ersten Weltkrieg, finde ich sehr nützlich da diese nicht nüchtern Fakten sondern das Mitgefühl ansprechen.In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Schriften des Erasmus von Rotterdam hinweisen wie „Die Klage des Frieden“ und „Soldatenbeichte“. Diese Schriften um 1517 geschrieben haben an ihrer aktualität nichts verloren.Über die im 1.Weltkrieg gefallenen Mansfelder Berg-und Hüttenleute habe ich einen Dokumentarfilm gestaltet und in 06311 Helbra der Öffentlichkeit vorgestellt.Viele der (Senioren ) Zuschauer konnten ihre gefallenen Vorfahren wiedererkennen und so manchen standen die Tränen in den Augen. Diesen Film habe ich meinem Enkel zur Mahnung gewidmet damit er nicht jenen im Leben folgt, die Scheinheilig vom gerechten Krieg oder gerechten Frieden reden.