Am Samstag, den 3. Mai hatte das Stück „Glaube, Liebe, Hoffnung“ Premiere im Theater Trier. Charles Muller, Direktor des Stadttheaters Esch/Luxemburg, übernahm die Regie des Gesellschaftskritischen Klassikers von Ödön von Horvath.
Elisabeth will ihren Leichnam verkaufen. Natürlich ihren zukünftigen, immerhin will sie ja noch ein bisschen leben. Aber um leben zu können braucht sie Arbeit. Und um arbeiten zu können, braucht sie Geld für einen Wandergewerbeschein. Und deswegen will sie ihren zukünftigen Leichnam an das anatomische Institut verkaufen. Dumm nur, dass sie ihre Quellen offenbar nicht gut informiert haben. Das anatomische Institut kauft keine Leiber. Allerdings hat einer der Präparatoren ein weiches Herz und stiftet der Tochter eines Inspektors, eines Zoll-Inspektors wie er denkt, die 150 Mark.
Geld statt Liebe
Wie sich herausstellt ist Elisabeth gar nicht die Tochter eines Zoll-Inspektors, sondern eines hundsgewöhnlichen Versicherungs-Inspektors. Das ist natürlich etwas vollkommen anderes, echauffiert sich der Präparator und will sein geliehenes Geld augenblicklich zurück. Wie sich wiederum herausstellt hat Elisabeth das Geld gar nicht für ihren Gewerbeschein ausgegeben, der wurde ihr nämlich vorgestreckt, sondern für eine Geldstrafe, die ihr aufgedrückt wurde. Für das Arbeiten ohne Gewerbeschein. Betrug ist das und Elisabeth wird zu 14 Tagen Haft verurteilt. Vorbestraft, ohne Job, verbringt sie ihre Tage im Wohlfahrtsamt, bekommt dort zwar keine neue Arbeit, lernt dafür aber den Schupo Alfons kennen. Der macht ihr einen Heiratsantrag. Doch als er von ihrer Vorstrafe erfährt, entscheidet er sich statt für die Liebe, lieber fürs Geld. Am Ende bleibt Elisabeth nur noch ein Weg. Der ins Wasser.
Ödön von Horvaths Stück über eine Frau, die sich nicht nur durch eine schwierige Zeit, nämlich die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, kämpfen will, sondern auch über eine Gesellschaft, in der jeder der durchs Raster fällt, ein Maul weniger ist, was gestopft werden muss.
 Elisabeth ist dabei eine Frau, die sich noch nicht aufgegeben hat. Die ihren Lebensunterhalt noch mit harter Arbeit verdienen möchte, selbstständig bleiben möchte, unabhängig. Unabhängig von der Gesellschaft, einem Mann oder ihrem Vater. Eine Kämpfernatur, die tragischerweise an Lappalien scheitert. Die Gesellschaft um sie herum: zu sehr damit beschäftigt das eigene Leben zu erhalten. Keine Zeit und keine Geduld für Verständnis, obwohl die Situation des Anderen genau dieselbe ist wie die eigene.
Elisabeth ist dabei eine Frau, die sich noch nicht aufgegeben hat. Die ihren Lebensunterhalt noch mit harter Arbeit verdienen möchte, selbstständig bleiben möchte, unabhängig. Unabhängig von der Gesellschaft, einem Mann oder ihrem Vater. Eine Kämpfernatur, die tragischerweise an Lappalien scheitert. Die Gesellschaft um sie herum: zu sehr damit beschäftigt das eigene Leben zu erhalten. Keine Zeit und keine Geduld für Verständnis, obwohl die Situation des Anderen genau dieselbe ist wie die eigene.
Schade, dass dieser Eindruck in der Inszenierung von Charles Muller nicht entstehen will. Elisabeth, gespielt von Fabienne Elaine Hollwege, erscheint nicht als Kämpfernatur, die schließlich an den kleinen, gemeinen Ungerechtigkeiten des Lebens zerbricht. Sondern eher als naives Mäuslein, das gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Das nicht von einer egozentrischen Gesellschaft überrannt wird, sondern schlicht und ergreifend den Mund nicht aufbekommt. Es entsteht der Eindruck, dass diese Elisabeth nicht um ihr Glück kämpft, sondern vielmehr darum, dass ihre ganzen Lügen nicht aufgedeckt werden.
Wenig Gefühl hinterm grauen Schleier
Die Figur des Alfons, alias Jan Brunhoeber, erscheint als strenger, gradliniger Staatsdiener, der in Elisabeth seine verstorbene Braut erkennt und gar nichts dagegen hat eine Frau unter sich stehen zu haben. Ganz im Gegenteil, eine selbstständige Frau ist gar nicht sein Geschmack. An dieser Stelle beißt sich Gesagtes mit dem Gesehenen. Elisabeth, die eigentlich immer selbstständig von den Männern sein wollte, scheint sich nur zu gerne in den sicheren Hafen der Ehe mit einem Staatsdiener zu retten. Generell geht die Beziehung der beiden nicht ganz auf: Er scheint nach einem Ebenbild seiner Braut zu suchen, mit der er ein Herz und eine Seele war und sie wirkt oft als wäre sie naiv hineingeschlittert und hätte eben das Beste daraus gemacht.
Generell fehlt es der Inszenierung an zwei Punkten: Gefühl und Tiefe. Charakterlich sind die zahlreichen Nebenfiguren oft ausgefeilter als die beiden Hauptfiguren. Allen voran die Figuren, die durch Tim Olrik Stöneberg, Christian Miedreich und Friederike Majerczyk verkörpert werden, als Oberpräparator oder tollkühner Lebensretter, Vizepräparator und Oberinspektor oder Prostituierte Maria.
 Hier kann man etwas vom rauen Leben in der Zeit der Rezession ausmachen, vom Zeitgeist. Das eben zur Not jeder der Haifisch im Fischschwarm sein will und kann. Und Not besteht praktisch immer. Diesen Eindruck verstärken das Bühnenbild von Helmut Stürmer und die Lichtinstallationen von Philippe Lacombe. Ein klares, sehr geometrisches, dennoch bewegliches Bühnenbild. Mit haushohen, transparenten Wänden, durch die gekonnt mit Licht und Schatten gespielt werden kann. Während der Umbauten spielen die Figuren über die Bühne, laufen suchend aber ohne Ziel ihrer Suche über die Bühne.
Hier kann man etwas vom rauen Leben in der Zeit der Rezession ausmachen, vom Zeitgeist. Das eben zur Not jeder der Haifisch im Fischschwarm sein will und kann. Und Not besteht praktisch immer. Diesen Eindruck verstärken das Bühnenbild von Helmut Stürmer und die Lichtinstallationen von Philippe Lacombe. Ein klares, sehr geometrisches, dennoch bewegliches Bühnenbild. Mit haushohen, transparenten Wänden, durch die gekonnt mit Licht und Schatten gespielt werden kann. Während der Umbauten spielen die Figuren über die Bühne, laufen suchend aber ohne Ziel ihrer Suche über die Bühne.
Eine schöne Idee, die den Geist der Inszenierung einfangen soll. Leider erscheint der Rest der Inszenierung wie die zeitgenössisch wunderbar eingefangenen Kostüme von Kathelijne Schaaphok: nämlich grau in grau. Horváths Sprache erscheint oft künstlich, bis sie zum Leben erweckt wird: durch Spiel und Gefühl. Fehlt dieses bleiben seine Worte holprig und gestelzt. Leider ist dies im Theater Trier viel zu oft der Fall gewesen.
Das Premierenpublikum reagierte dennoch voller Begeisterung. Warf sogar Blumen auf die Bühne. Wünschenswert, dass das Stück weiterhin so großen Anklang findet.
Fazit: Leider eine sehr distanzierte Inszenierung ohne Gefühl, die die Zuschauer emotional nicht auf die Seite der Figuren ziehen, sondern fern als stille Beobachter halten will. Leider erscheint nur aus der Beobachtung heraus vieles unverständlich, wie etwa der Selbstmord von Elisabeth, der fast als Trotzreaktion gegen Alfons erscheint. Und nicht als das letzte Mittel einer Frau, die sich nicht aufgeben will. Ohne Gefühl in der Inszenierung bleibt diese eben leider wie hinter einem Grauschleier.
Fotos: Marco Piecuch


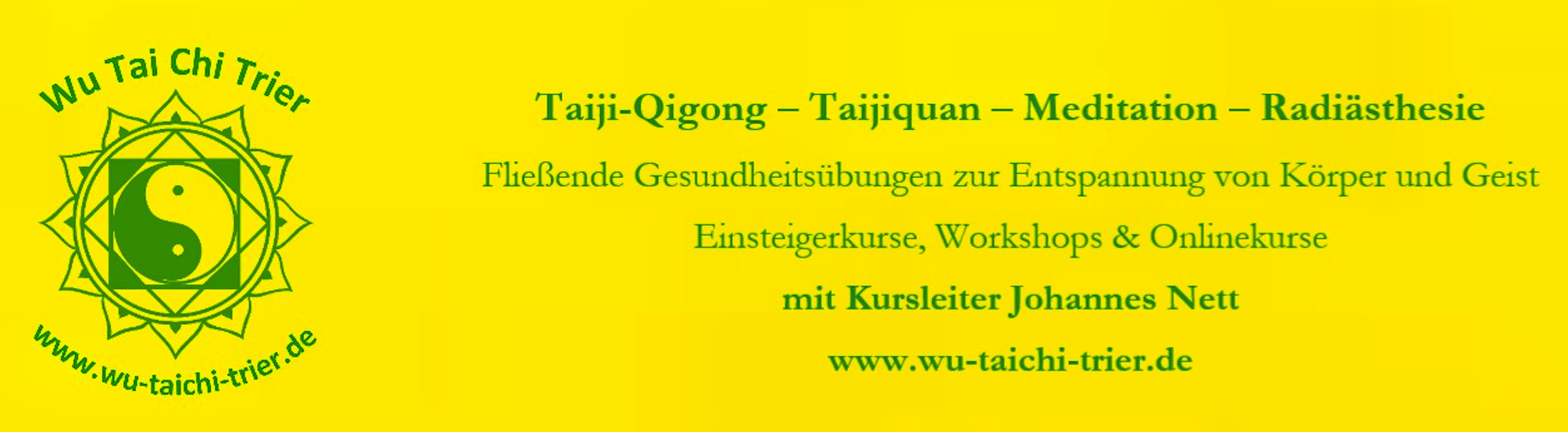
Kommentar verfassen